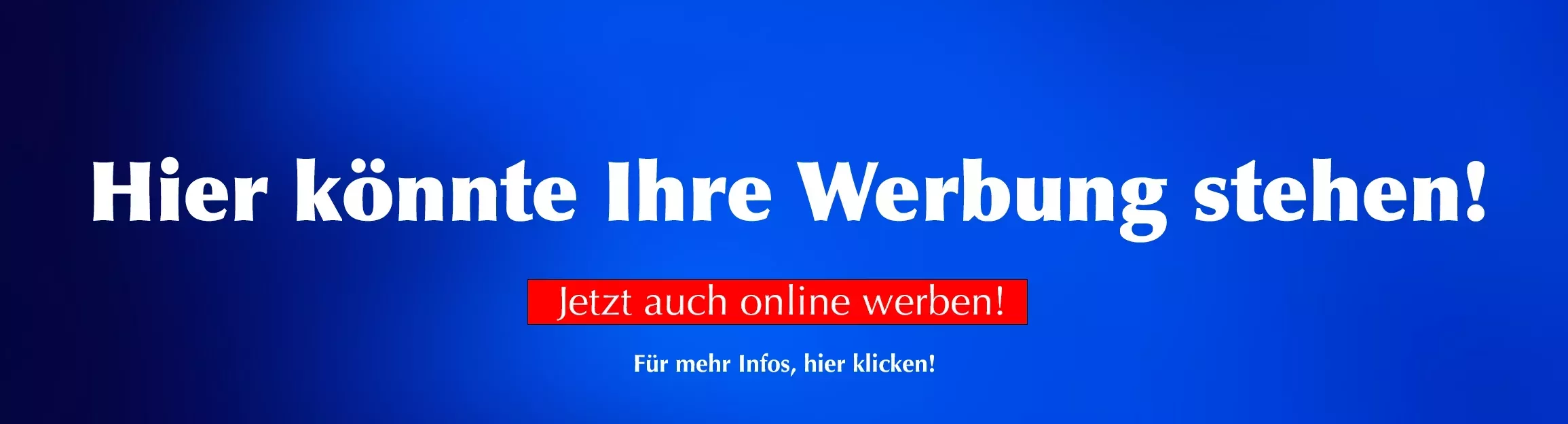80 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg
Es gibt viele Gründe, diesem Tag unbedingt zu gedenken
Die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist das Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa. Der 8. Mai steht für das Ende des Nationalsozialismus in seiner bis dahin aktiven, menschenverachtenden und grausamen Form und er steht für das vorläufige Ende von unermesslichem Leid. Es gibt viele Gründe, diesem Tag unbedingt zu gedenken.
„Ein Hauptgrund ist, die Erinnerung an diese dunkle Zeit wachzuhalten, damit wir nicht aufhören, aus der Vergangenheit zu lernen“, betont Landrat Dr. Theophil Gallo, Vorsitzender der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Saar, der mit Demut auf diesen Tag blickt.
Von dem völkerrechtswidrigen Angriff der deutschen Wehrmacht unter Hitler auf Polen am 1. September 1939 können nicht mehr allzu viele Zeitzeugen aus persönlichen Erfahrungen berichten. Doch vielerorts sind die Auswirkungen der Geschehnisse heute noch spürbar.
„Die Polen traf dieser Krieg vom ersten Tag an mit grausamer Härte, wir sprechen von einem unfassbaren Terror gegen die polnische Bevölkerung. Kein Wunder, dass das deutsch-polnische Verhältnis noch Jahrzehnte nach Kriegsende stark belastet war. Was mich schon bei meinem ersten Besuch in Polen am meisten beeindruckte und es noch immer tut, sind die dennoch uns entgegengebrachte Unvoreingenommenheit und Offenheit, trotz aller Gräueltaten. Selbst wenn es 80ß Jahre her sind, so verdient gerade Polen unsere Aufmerksamkeit etwa über sporadische Besuche bei Jahrestagen hinaus. Wir müssen den Austausch und die Begegnungen verstärken, gerade auch im Bereich der Kultur, im Bereich der Schulen und der Jugend“, appelliert der Landrat.
Auch im Saarpfalz-Kreis, wo im Bliesgau gegen Ende des Krieges mehrere Monate die Front verlief, erzählen Großeltern und Eltern heute noch den nachfolgenden Generationen von Bombardierungen, vom Verstecken in Kellern, von dramatischen und schmerzlichen Verlusten in der eigenen Familie. Viele Soldaten kehrten nicht mehr zu ihren Frauen und Kindern zurück. Andere Soldaten erfuhren bei ihrer Rückkehr, dass ihre Frauen und Kinder im Bombenhagel umgekommen sind.
Nach dem verheerenden Zweiten Weltkrieg standen in Europa das Leben, der Wiederaufbau, die politischen Weichenstellungen, die wirtschaftlichen Entwicklungen usw. über Jahrzehnte im Zeichen des Friedens.
Frieden, ja, und doch wieder nicht? Auch nach 1945 gab es in Europa und in den früheren Sowjetrepubliken bis heute bewaffnete Konflikte, bei denen hunderttausende Menschen zu Tode kamen. Dazu zählte u. a. der Konflikt in Zypern 1974, der Krieg auf dem Balkan in den 1990er Jahren, zu nennen sind Tschetschenien, ebenfalls in den 90ern, und Georgien 2008. Die meisten Konflikte wurden als Separatismus- oder Bürgerkriege deklariert.
In diesem Zusammenhang erinnert Landrat Dr. Gallo an das Massaker von Srebenica (Bosnien und Herzegowina) im Juli 1995. Es gilt als der dunkelste Moment Europas in der jüngeren Geschichte und als das schwerste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges.
„Wer sich nicht vorstellen kann, was in vermeintlich friedlichen Zeiten passieren kann – der Völkermord liegt jetzt 30 Jahre zurück – der sollte sich den Film „Quo Vadis, Aida?“ aus dem Jahr 2020 anschauen. Er zeigt die unmittelbare Vorgeschichte des Massakers und er geht von der ersten Minute an unter die Haut. Als der damalige Kommandeur der niederländischen UNO-Truppe, die mit dem serbischen Militär unmittelbar konfrontiert war, Rat bei seinen Vorgesetzten suchte, waren diese nicht erreichbar, sie waren in Urlaub oder im Wochenende.
Und heute? Heute muss die Ukraine um ihr Überleben kämpfen, um ihre Freiheit. Der Gegner ist bekannt. Die Zahl der Todesopfer im Ukraine-Krieg auf beiden Seiten bleibt nach wie vor unklar. Es wird von über 100 000 Soldaten und Zivilisten gesprochen. Auf jeden Fall bewegen wir uns erneut in einem Spektrum, das unsere Vorstellungskraft über die Geschehnisse aushebelt. Das bedeutet nicht, dass wir uns entziehen dürfen. Im Gegenteil. Wir leben in Europa, in Deutschland, nunmehr in einer Zeit, in der die Menschen den Wert der Demokratie zunehmend nicht mehr erkennen oder vernachlässigen, in der man vielleicht keine Notwendigkeit mehr sieht, sich um Demokratie zu bemühen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer indes setzen dafür ihr Leben aufs Spiel. Es gab so viele Warnzeichen auf Putins, auf Russland Vorgehen gegen die Ukraine, spätestens seit 2014. Doch der Westen hat seinen Wohlstand über jedes Leid gestellt und nicht oder nur zögerlich reagiert. Alle wähnten sich in Urlaub, wie im Film Quo Vadis, Aida. Dies gilt bis heute, wo man vor den ständigen Atomdrohungen Russlands einknickt und, anders als vor drei Jahren, sich des Schutzes durch die USA nicht mehr sicher sein kann. Das Aufkommen der Rechtsextremen zeigt weiter, dass Kräfte am Werk sind, die versuchen, Europa auszuhöhlen. Wenn wir unseren Kindern und Enkelkindern friedliche Zukunftsperspektive ermöglichen wollen, müssen wir uns sowohl der historischen als auch der gegenwärtigen Verantwortung stellen, die demokratischen Grundwerte zu achten und zu leben – sodass Konflikte auch gewaltfrei gelöst werden können.
Mit seiner Aussage behält unser ehemaliger Bundeskanzler (1969 – 1974) Willy Brandt (* 18. Dezember 1913, † 8. Oktober 1992) heute noch Recht: „Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts.“ © Saarpfalz-Kreis